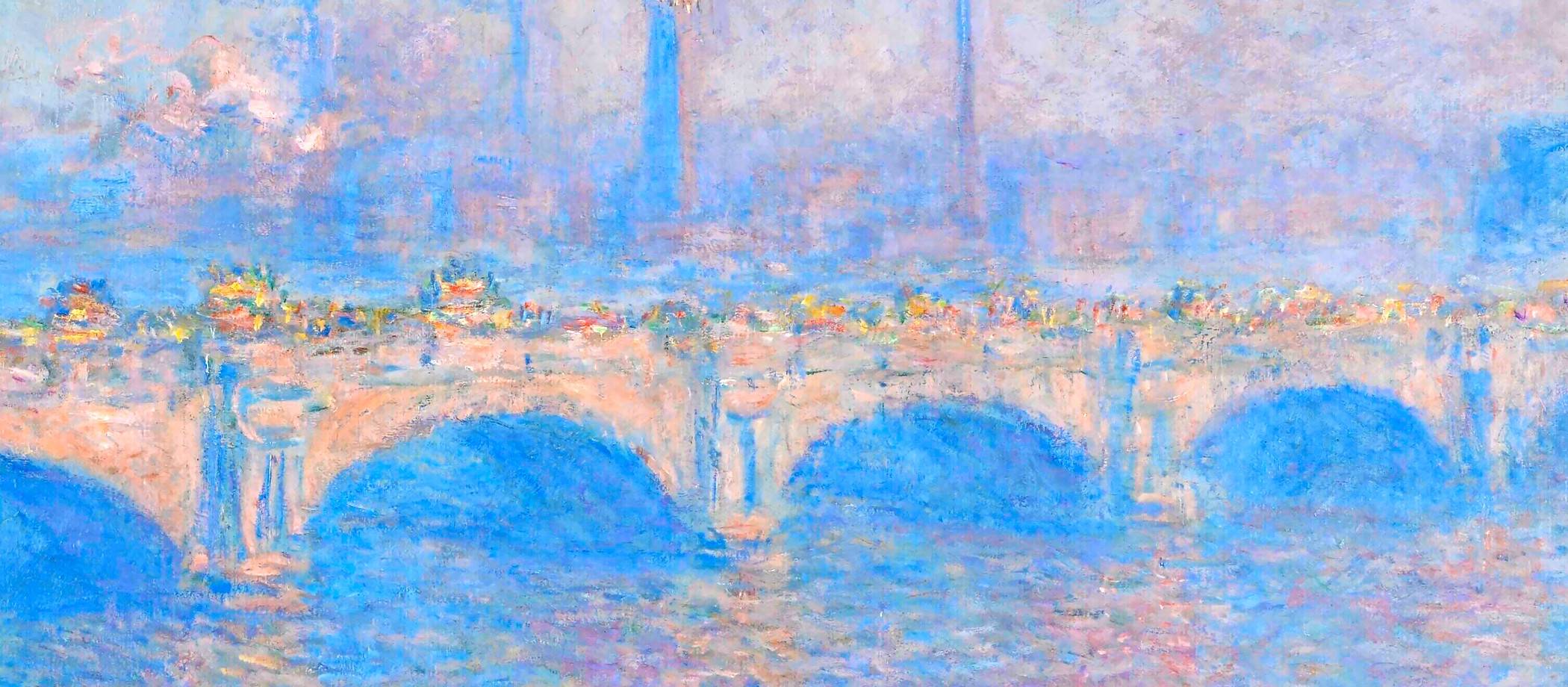„Menschen auf dem Spektrum wären hier aufgrund der Lautstärke total überfordert, eigentlich sind sie für mich alle Superhelden.“ Sie lächelt dabei etwas. Doch es ist ihr bitterernst – im Umgang mit Autismus sieht sie in Düsseldorf bei Inklusion, Betreuung, Hilfsangeboten aber auch den Mitmenschen noch sehr viel Luft nach oben…
Zu Beginn der Unterhaltung fällt das Wort von der Erkrankung. „Da grätsche ich dann immer schon gleich rein“, sagt sie. „Das stört mich unheimlich.“ Die geläufige Diagnose Autismus Spektrum- Störung (ASS) sei keine Krankheit. „Wir sprechen von einer Entwicklungsverzögerung von Kindern, das ist Fakt. Viele holen gewisse Verspätungen auch nicht mehr auf. Aber auch in ganz individuellen Ausprägungen“ (siehe Infokasten, die Red.). Durch den Krankheits-Begriff fühlten sich viele Betroffene stigmatisiert, verletzt, angegriffen. „ich spreche da lieber von Neurodiversität, im Gegensatz zum neurotypischen Verhalten“, so Bechberger.
Das Gehirn funktioniere anders, da spielten biochemische Zusammenhänge, verschiedene Hormone eine Rolle. Ein EEG etwa zeige Unterschiede zwischen einem autistischen Gehirn und einem neurotypischen. „Autisten kommen schwer mit äußeren Eindrücken, etwa akustischen, sensorischen oder visuellen Reizen zurecht, deren Verarbeitung ist verlangsamt.“ Tanja Bechberger schüttelt den Kopf. „Was die am Tag alles aushalten.“ Die Interaktion ist besonders, es sei schwierig, etwa Smalltalk zu führen. „Wir lernen als kleines Kind, Gesichter zu lesen, das ist uns angeboren. Autistische Menschen können das nicht – oder sie lernen sie auswendig.“
Bei Max sei der schon damals alleinerziehenden Mutter mit rund anderthalb Jahren erstmals aufgefallen, „dass er manchmal lange ins Nichts starrte, selbst wenn ich mit den Fingern vor seinen Augen schnippte.“ Bis dahin sei alles recht normal gewesen. Max habe viel gelacht. Gravierende Veränderungen stellten sich dann mit drei Jahren im Kindergarten ein. „Die Kita-Leitung meldete sich“, erzählt Bechberger. „Mein Sohn würde sich seltsam verhalten. Er drücke Kinder an die Wand, um nach eigener Aussage zu sehen, ob sie quietschten.“
Der Junge zog sich zurück, fixierte sich zunehmend auf Gegenstände, war nur kommunikativ, was seine Interessen anging, wies dabei jedoch einen hohen Sprachschatz auf. Die Diagnose stand dann etwa mit dem Wechsel in die Schule. Der Weg dahin sei gepflastert mit Hindernissen gewesen, betroffene Eltern wären da bis heute ganz schnell überfordert. Bechberger: „Es gab zu wenig fachspezifisches Personal, ganz selten kam ein Autismus-Spezialist dazu. Dafür herrscht bis heute überbordende Bürokratie. Es gibt veraltete Verfahren – Max sollte Intelligenztests für Neurotypische machen, diese machen jedoch keinen Sinn, da die Wahrnehmung und das Verständnis von Menschen mit Autismus ganz anders ist.“ Beim Gesundheitsamt sollte Max auf einem geraden Strich gehen. Bechberger: „Völlig unnötig!“
Sie hat recherchiert, dass im Raum Düsseldorf einige 1000 Menschen im Alter bis 16 Jahren mit Autismus diagnostiziert sind. „Es gibt aber eine Dunkelziffer und das ist schlimm. Denn man benötigt die Diagnose, um in die Förderung zu kommen.“ Das führe gerade bei Spät- oder gar Nicht-Diagnostizierten dazu, dass Autisten im Schatten der Gesellschaft stehen. Aufgrund fehlender Unterstützung, Stigmatisierungen und sozialer Ausgrenzung häuften sich Depressionen bis hin zu Suizidgedanken. Auch politisch müsse mehr kommen: Kaum genügend Personal für Elterngruppen, kaum Räumlichkeiten für Menschen auf dem Spektrum im jungen Erwachsenenalter.
Und dann die Schule! Max kam in eine Montessori-Grundschule. „Er hatte dort aufgrund der Schulform ein gewisses Entfaltungsfeld, es lief gut für ihn.“ Dennoch, man habe mit geschlechterspezifischer und feministischer Diversität geworben – „warum nicht auch auf dem Autismus-Feld“, fragt Tanja Bechberger. Danach versuchte Max es auf einem inklusiv ausgerichteten Gymnasium. „Nach vier Tagen habe ich ihn da nicht mehr hingeschickt. Das Lehrpersonal war auf Autismus nicht vorbereitet, obwohl man mir in Vorgesprächen einen anderen Eindruck vermittelte.“ So sei es etwa nicht möglich gewesen, dass Max während des Unterrichts mal rausgehen könne, um sich zu „setteln“, runterzukommen. Schließlich sei er auf dem Pausenhof beschimpft und geschlagen worden. Bechberger: „Statt präventiv mit den Kindern ins Gespräch zu gehen, ging es denen danach nur um Täteridentifizierung.“
Eine ausgesprochene Autismus-Schule, wie es sie etwa in Belgien in jeder Stadt gebe, habe Düsseldorf nicht. „Dort können die Kinder alle drei Tage zuhause bleiben, um zur Ruhe zu kommen.“ Max‘ Option war der Besuch der Jan Wellem-Förderschule in Oberbilk, auf die er auch aktuell noch geht. „Alle Beteiligten arbeiten gut zusammen, es herrscht stetiger Austausch mit einem kompetenten Direktor“, freut sich Bechberger.
Aber ja, noch mehr mache Hoffnung: Sie nähme zunehmenden Austausch zwischen städtischen Behindertenrat und den Sozialträgern wahr. Menschen nähmen mehr Rücksicht – „wenn ich vor zehn Jahren gesagt hätte, mein Kind hat Autismus, können sie die Musik leiser machen, man hätte durchgehend mit den Augen gerollt. Heute wird das sofort gemacht.“ Ein Düsseldorfer Kino habe zuletzt erstmals eine Filmveranstaltung für Menschen auf dem Spektrum gemacht - mit gedämpftem Licht und Ton.
Aber Tanja Bechberger möchte das System noch besser machen. Sie hat als inzwischen zertifizierte psychologische Beraterin und Personal Coach zusammen mit ihrer Cousine ein kleines Familienunternehmen gegründet, bietet Workshops in Kitas und Schulen an, um den Kindern zu erklären, was Autismus ist und sucht den Austausch mit Eltern. Ein Kurs „Autismus verstehen“, ausgelegt für Mitarbeitende in Kita, Schule oder Kindertagespflege, ist im Angebot. Sie betont dabei ihren persönlich gelebten Blickwinkel auf Autismus. „Die Menschen sollen ASS besser wahrnehmen und verstehen.“ Man müsse die Leute da draußen erreichen, die Max, wenn er beim Metzger steht, blöd anstarren, weil er nicht Hallo sage. „Er ist nicht dumm oder unhöflich, er hat Autismus.“
Und Max‘ Zukunft? Tanja Bechberger erzählt, dass er derzeit nicht in der Lage sei, kleine Strecken alleine zu gehen. „Er ist so abgelenkt, da ist es gefährlich, die Straße zu überqueren. Ich übe mit ihm, es wird wahrscheinlich besser.“ Auch kann sie nicht lange von Zuhause fortbleiben, ist Max unbeaufsichtigt, wagt sie sich lediglich in benachbarte Stadtteile. „Das ist unsere Realität, so tasten wir uns heran.“ Man könne heute nicht sagen, ob er irgendwann mal alleine wohnen wird. Arbeiten durchaus, er sei interessiert an Journalismus. Tanja Bechberger wünscht sich, „dass er immer eine Strategie entwickelt, um glücklich zu sein, dass er eine Partnerschaft haben kann und in seinem Leben immer mehr Akzeptanz findet.“
Derweil schaut sie sich immer wieder etwas von ihm ab. Neulich waren sie an einem Sonnentag unterwegs, hatten es eigentlich eilig. Da blieb Max stehen und schaute in eine Baumkrone, wo das Licht mit den Blättern spielte. „Er ist immer im Moment, nimmt die Dinge so wahr, wie sie gerade kommen. Das ist eine tolle Fähigkeit“, sagt seine Mutter. „Ich bin viel bewusster durch ihn geworden.“ Sie ist dann auch stehengeblieben...